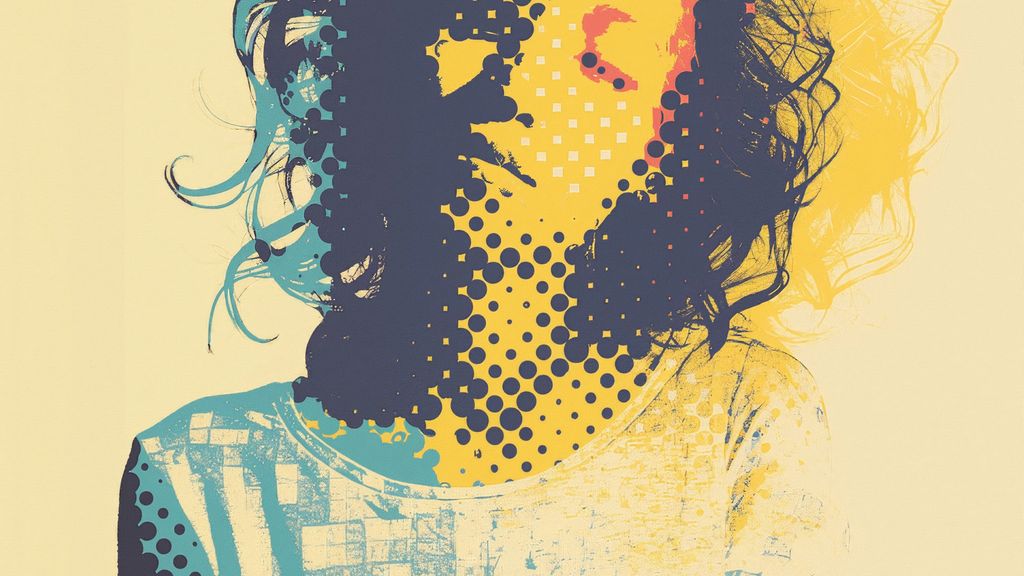
Schizophrenie: Therapie durch gezielte Auswahl der Medikamente und Einbindung von Angehörigen und Peers
Unser Gesprächspartner:
Prof. Dr. med. Gregor Hasler
Chefarzt am Freiburger Netzwerk für Psychische Gesundheit, Freiburg
Präsident der Schweizer Gesellschaft für Bipolare Störungen
E-Mail: gregor.hasler@unifr.ch
Das Interview führte Dr. med. Felicitas Witte
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
In den vergangenen Jahren hat es nicht die Erfolge bei der Entwicklung neuer Medikamente gegeben, die sich Schizophrenieforscher gewünscht haben. Trotzdem kann den Patient:innen heute besser geholfen werden, und sie haben eine höhere Lebensqualität. Wir sprachen mit Prof. Dr. med. Gregor Hasler, Präsident der Schweizer Gesellschaft für Bipolare Störungen (SGBS).
Herr Professor Hasler, als Sie begannen, sich mit Schizophreniezu beschäftigen – was war damals Stand der Dinge?
G. Hasler: Ende der 1990er-Jahre gab es schon die ersten Antipsychotika der zweiten Generation. Endlich konnten wir vielen Patient:innen die lästigen extrapyramidalen Symptome und Spätdyskinesien ersparen. Vieles war aber noch unklar, und es kam einem manchmal so vor, als tappe man im Dunkeln. Bei einigen Patient:innen erreichten wir eine vollständige Remission, aber es kam auch vor, dass wir mehrere Präparate ausprobierten, bis wir eines gefunden hatten, das wirkte. Das ist leider heute auch noch so. Damals hoffte man, Subtypen zu finden, die den Verlauf und das Ansprechen auf die Medikamente vorhersagen könnten. Leider ergab sich hier wenig. Man versuchte dann, mithilfe von Magnetresonanztomografie (MRT) oder Genanalysen die Pathogenese und Heterogenität der Krankheit besser zu verstehen und die Therapie anzupassen, aber auch hier erfüllten sich bis jetzt die Hoffnungen nicht.
Was hat sich in den letzten 30 Jahren getan?
G. Hasler: Wir haben immer noch keine Biomarker, und so dauert es nach wie vor häufig Wochen oder gar Monate, bis die Diagnose gestellt ist. Immerhin sind seit meiner Ausbildung einige neue Medikamente auf den Markt gekommen. Sie sind zwar leider nicht wirksamer als die älteren Präparate, aber durch die bessere Verträglichkeit wurde die Lebensqualität der Patient:innen erhöht. Wir versuchen heute, individueller auf die Patient:innen einzugehen. Wir legen mehr Gewicht auf die Behandlung neuropsychologischer Störungen, zum Beispiel Konzentrationsstörungen, die massgeblich zur Invalidität beitragen können. Auch die Früherkennung hat mehr Bedeutung bekommen. Die AWMF-Leitlinie1 empfiehlt, bei bestimmten Personen gezielt nach einem erhöhten Psychoserisiko zu suchen und die Betroffenen dann engmaschig zu beobachten. So kann man frühzeitig eingreifen. Wir binden heute auch die Angehörigen mehr ein.
Warum das?
G. Hasler: Früher sah man die Eltern primär als Risikofaktor. Heute wissen wir, dass sie wichtige Partner in der Behandlung sind. So gibt es beispielsweise Hinweise, dass Psychoedukation unter Einbeziehung der Angehörigen bezüglich Rezidivreduktion wirksamer ist als ohne sie.2 Es wird deshalb empfohlen, Angehörige und andere Vertrauenspersonen einzubeziehen, und auch, wenn es zu einer Exazerbation kommt oder zu einem Rezidiv.1 Psychotherapeutische Familieninterventionen, so zeigten diverse Untersuchungen, senkten das Rezidiv- und Hospitalisierungsrisiko. Auch Peers – also andere Menschen mit Schizophrenie und deren Familien – können den Betroffenen helfen, denn diese bekommen dadurch mehr Zuversicht und erholen sich schneller.3
Apropos Behandlung: Hierzulande sind 21 Antipsychotika zugelassen (Tab. 1). Wie findet man das richtige Präparat?
G. Hasler: Da die Wirksamkeit der Substanzen vergleichbar ist, spielt bei der Auswahl das Nebenwirkungsprofil eine wichtige Rolle. In den Schweizer Therapieempfehlungen4 findet sich eine nützliche Tabelle, wie häufig gewisse Nebenwirkungen bei dem jeweiligen Präparat auftreten. Starten sollte man – da sind sich die Leitlinien1,4 einig – mit einem Antipsychotikum der zweiten Generation. Denn diese bergen per se weniger extrapyramidale Nebenwirkungen. Dann schaut man, welche Risiken für somatische Krankheiten die Patient:innen haben und ob er oder sie schon einmal ein Antipsychotikum bekam. Hat er oder sie zum Beispiel ein metabolisches Syndrom, ist Olanzapin weniger günstig als beispielsweise Aripiprazol oder Amisulprid. Denn Olanzapin führt häufig zu Hyperglykämie, Hyperlipidämie und Gewichtszunahme, während dies bei den beiden anderen Präparaten kaum oder gar nicht der Fall ist. Bei Therapie-Resistenz wird in den Richtlinien ein Versuch mit Clozapin empfohlen. Dies scheint mir sehr wichtig, weil es den Patient:innen erspart, möglicherweise unnötig ein weiteres Antipsychotikum zu probieren. In Real-World-Studien war Clozapin bei Therapie-Resistenz anderen Antipsychotika überlegen: Es führte zu weniger Hospitalisierungen und Behandlungsabbrüchen.5–7
Kann man bei Therapie-Resistenzverschiedene Antipsychotikakombinieren?
G. Hasler: In Studien wurden fast immer nur Monotherapien untersucht, und dies spiegeln auch die Empfehlungen wider. In einer Klinik haben wir es aber oft mit schwerkranken Patient:innen zu tun, die wissenschaftlich nur ungenügend erforscht sind. Deshalb kann es bei Therapie-Resistenz sinnvoll sein, auch Kombinationen auszuprobieren. Vorher muss man aber sicherstellen, dass wirklich eine Therapie-Resistenz vorliegt oder ob der/die Patient:in vielleicht noch andere Krankheiten hat, der Plasmaspiegel nicht erreicht wurde oder ob er/sie seine/ihre Medikamente nicht nahm. Non-Adherence und Non-Compliance sind ein grosses Problem. Die Patient:innen sehen nicht immer ein, dass die Behandlung notwendig ist, manche vergessen auch die Einnahme wegen Konzentrationsproblemen.
Sind Depot-Präparate hier eine Option?
G. Hasler: Depot-Präparate haben das grosse Potenzial, die Wirksamkeit zu steigern und gleichzeitig die Verträglichkeit zu verbessern. Für die Depot-Behandlung genügen oft geringere Dosierungen, weil die Konzentration im Körper konstanter ist als bei der oralen Einnahme. Es kommt seltener zu Rückfällen, weil die Patient:innen die Einnahme nicht vergessen. Alle Patient:innen, bei denen eine Dauertherapie indiziert ist, sollten über die Möglichkeit der Depot-Applikation informiert werden. Oft fürchten sich die Patient:innen vor einem Verlust der Autonomie. Das muss man mit ihnen besprechen: Um welche Autonomie geht es? Wovor haben sie Angst?
Welchen Patient:innen empfehlenSie eine stationäre Therapie?
G. Hasler: Für mich gilt der Grundsatz: ambulant vor stationär. Aber gewisse Patient:innen sind mit dem ambulanten Rahmen überfordert und eine Klinik hat hier grosse Vorteile. Zum Beispiel, um Patient:innen vor Fehlernährung, metabolischen Krankheiten, Drogen oder auch vor Gewalt zu schützen. In Ländern, in denen es sehr wenige stationäre Angebote gibt, etwa in den USA, landen viele Patient:innen leider in Gefängnissen, weil man ihr Verhalten als bedrohlich erlebt. Dies hat einen negativen Impact auf die Lebensqualität, aber auch auf die körperliche Gesundheit und den Langzeitverlauf.
Wie schaffen Sie eine vertrauensvolle Beziehung zu Patient:innen?
G. Hasler: Das krankheitsbedingte Misstrauen kann eine erhebliche Herausforderung für die therapeutische Beziehung sein. Umso wichtiger ist es, sich Zeit zu nehmen, geduldig zuzuhören und offen zu bleiben. Bedauerlicherweise sind auch wir Fachleute nicht frei von Stigmatisierungen. Einerseits gilt die Psychiatrie innerhalb der Medizin oft als weniger angesehenes Fach, andererseits besteht die Gefahr, dass wir selbst – bewusst oder unbewusst – Patient:innen mit Schizophrenie weniger ernst nehmen oder ihnen weniger zutrauen als anderen. Deshalb braucht es Anti-Stigma-Initiativen nicht nur in der Öffentlichkeit oder am Arbeitsplatz, sondern auch innerhalb unseres eigenen Berufsstandes.
Was erhoffen Sie sich von der nahen Zukunft?
G. Hasler: Ich habe zwei Wünsche: Erstens, dass wir bessere Biomarker finden. Die Schwierigkeiten bei der Bildgebung wurden mir früh bewusst. Deshalb habe ich mich neuen Methoden zugewendet, die nicht einfach nur das Volumen oder die Aktivierung von ganzen Hirnregionen untersuchen, sondern einzelne Moleküle und Botenstoffe messen, etwa mittels PET und MR-Spektroskopie (MRS). Eine grosse kombinierte PET/MRS-Studie bei Frühformen der Psychose habe ich in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich und der Universität Zürich gerade abgeschlossen. Zu den Ergebnissen kann ich leider noch nichts sagen.
Was ist Ihr zweiter Wunsch?
G. Hasler: Dass wir endlich Medikamente mit neuen Wirkmechanismen bekommen. Zwar ist in den USA seit Kurzem KarXT auf dem Markt, eine Kombination aus Xanomelin und Trospiumchlorid. Die Ergebnisse der placebokontrollierten Studien8,9 sind vielversprechend, aber erst muss sich zeigen, ob KarXT besser wirkt als die bisherigen Antipsychotika und wie sicher es langfristig ist. Leider wirkt aber auch KarXT letztendlich im Dopaminstoffwechsel. Es aktiviert Muskarin-Rezeptoren, was indirekt die Dopaminausschüttung in bestimmten Hirnregionen dämpft. Das mag ein wichtiger Fortschritt sein. Noch besser wären Medikamente mit völlig anderem Wirkmechanismus. Es gibt einige interessante Kandidaten, die beispielsweise am Glutamat-System ansetzen oder antientzündlich oder metabolisch wirken. Aber wir sind hier noch weit entfernt von einer Zulassung. Ich habe noch einen dritten Wunsch: Wir dürfen nicht vergessen, dass Menschen mit Schizophrenie eine deutlich verkürzte Lebenserwartung haben. Das geht zu einem kleinen Teil auf Suizide und Unfälle zurück und zu einem grossen Teil auf metabolische und kardiovaskuläre Krankheiten. Auch wenn wir «Hirndoktoren» sind, dürfen wir unseren wissenschaftlichen Fokus nicht nur aufs Hirn lenken, sondern müssen beginnen, Schizophrenie als systemische Krankheit zu verstehen.
Literatur:
1 DGPPN e.V. (Hrsg.) für die Leitliniengruppe: S3-Leitlinie Schizophrenie. Kurzfassung, 2019, Version 1.0, zuletzt geändert am 15. März 2019, verfügbar unter: https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/038-009.html 2 Lloyd-Evans B et al.: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials of peer support for people with severe mental illness. BMC Psychiatry 2014; 14: 39 3 Lincoln TM et al.: Effectiveness of psychoeducation for relapse, symptoms, knowledge, adherence and functioning in psychotic disorders: a meta-analysis. Schizophr Res 2007; 96: 232-45 4 https://www.psychiatrie.ch/fileadmin/SGPP/user_upload/Fachleute/Empfehlungen/d_Schizophrenia_Recommendations_final_Dez._2015_-_Anpassung_Tabelle_3_2018_10_31.pdf 5 McEvoy JP et al.: Effectiveness of clozapine versus olanzapine, quetiapine, and risperidone in patients with chronic schizophrenia who did not respond to prior atypical antipsychotic treatment. Am J Psychiatry 2006; 163: 600-10 6 Essock SM et al.: Cost-effectiveness of clozapine compared with conventional antipsychotic medication for patients in state hospitals. Arch Gen Psychiatry 2000; 57: 987-94 7 Lewis SW et al.: Randomized controlled trial of effect of prescription of clozapine versus other second-generation antipsychotic drugs in resistant schizophrenia. Schizophr Bull 2006; 32: 715-23 8 Kaul I et al.: Efficacy and safety of the muscarinic receptor agonist KarXT (xanomeline-trospium) in schizophrenia (EMERGENT-2) in the USA: results from a randomised, double-blind, placebo-controlled, flexible-dose phase 3 trial Lancet 2024; 403: 160-70 9 Kaul I et al.: Efficacy and safety of xanomeline-trospium chloride in schizophrenia: a randomized clinical trial. JAMA Psychiatry 2024; 81(8): 749-56
Das könnte Sie auch interessieren:
Silexan wirkt bei Angst und Depressionen
Angststörungen und Depressionen stellen in der klinischen Praxis häufig einander begleitende Komorbiditäten dar, die sich gegenseitig verstärken können. In einem aktuellen Review war das ...
Die Vergangenheit und Zukunft der biologischen Depressionsbehandlung im Überblick
Trotz erheblicher Fortschritte in der neurobiologischen Forschung basiert die Diagnose der Depression nach wie vor primär auf der klinischen Beurteilung von Symptomen und Verlauf. In ...
«Hyper-Arousal» statt Schlafmangel: neue Perspektiven bei Insomnie
Bei der Insomnie handelt es sich um eine der häufigsten neuropsychiatrischen Störungen, bei der das subjektive Empfinden teilweise stark von objektiven Messparametern abweicht. In einem ...


